






 Erlebt und geschrieben von Peter Wilhelm, ehemaliger Ing.-Assi. auf M/S "Mülheim-Ruhr", bearbeitet von Ralf Sander.
Erlebt und geschrieben von Peter Wilhelm, ehemaliger Ing.-Assi. auf M/S "Mülheim-Ruhr", bearbeitet von Ralf Sander.

MS "MÜLHEIM-RUHR"
|
MS "MÜLHEIM-RUHR"
DHHV
3696 BRT / 6350 tdw
L:109,58m B:15,72m T:6,75m
2 Viertakt-Sechszylinder Motoren mit zusammen 1900 PS gebaut von der Werft, Burmeister & Wain
9 Knoten
34 Mann Besatzung
Im Juni 1915 von Burmeister & Wain, Kopenhagen (Bau Nr.298) als SAN FRANCISCO an Rederi AB Nordstjernan, Stockholm (SWE), Mgr. Axel A. Johnson, abgeliefert. 26.05.1950 verkauft. 1.6.1950 registriert, für 2,4 Millionen SEK an "Brenntag" Brennstoff-, Chemikalien- & Transport GmbH, KR Hugo Stinnes Zweigniederlassung, Brennstoff- & Schiffahrts GmbH verkauft, umbenannt Mülheim-Ruhr. 23.6.1958 in Hamburg aufgelegt. 23.4.1959 zum Abbruch nach Belgien verkauft. 6.5.1959 ab Hamburg als Anhang des deutschen Schleppers Ochtum nach Antwerpen, Ankunft dort 9.5.1959
MS "Mülheim-Ruhr"
Hitze und heilige Kühe
29.11.1957 - 29.05.1958
Nachdem ich mit den Erfahrungen auf der BARBARA eigentlich von der Seefahrt die Nase voll hatte und selbiger den Rücken kehren wollte, stellte sich mir die Frage: "Was tun statt dessen?" Die Vorstellung in irgendeinem Betrieb als Schlosser mein Leben an der Werkbank zu fristen, entsprach nicht meiner Vorstellung von Freiheit und Abenteuer. Ich war gerade 20 Jahre alt und hatte mein Leben noch vor mir. Da draußen wartete eine große weite Welt voller Abenteuer auf mich und die wollte ich mir erobern. Außerdem nagte es an meinem Selbstwertgefühl, einer Aufgabe nicht gewachsen zu sein. So wollte und konnte ich nicht aufhören. Ich musste mir selbst beweisen, dass auch ich die Härte und das Stehvermögen hatte einen Job zu erledigen. Hatte ich doch in meiner Jugend haufenweise Abenteuerbücher gelesen und mich mit den harten Burschen, den Romanhelden, aber auch den Tatsachenberichten über Abenteurer und nicht zuletzt Seeleuten, identifiziert.
So setzte ich mir das Ziel: "Ein Schiff noch! Wenn es dann nicht klappt, dann habe ich eben den falschen Beruf gewählt."
Am 29 November 1957 musterte ich in Emden auf dem Motorschiff MÜLHEIM RUHR als Ing. Assistent an. Laut Eintragung in meinem Seefahrtsbuch unter Kapitän Schlüter in großer Fahrt auf unbestimmte Zeit.
Eigentlich wollte ich es bei einer anderen Reederei versuchen, aber die Umstände ergaben es, dass ich bei der gleichen Reederei, der Hugo Stinnes Zweigniederlassung, blieb. Natürlich war mir klar, dass ich hier die gleichen Leute wieder treffen könnte mit denen ich schon auf der BARBARA meine Schwierigkeiten hatte. Aber nach dem Motto: "Was mich nicht umbringt macht mich hart!" nahm ich das in Kauf.
Die "MÜLHEIM RUHR" war wohl schon damals eines der ältesten Schiffe der deut-schen Handelsflotte. Mein ältester Kasten sollte es jedenfalls sein.
Das Schiff war 1915 von der Burmeister & Wain Werft in Kopenhagen für eine schwedische Reederei unter dem Namen "San Francisco" gebaut worden. Man muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen. Noch während des 1. Weltkrieges auf Kiel gelegt, damit über 42 Jahre auf dem Buckel, und noch immer in Fahrt. Man sollte es nicht glauben, aber mit den ersten Maschinen, die einer besonderen Betrachtung wert sind.
Zwei 6-Zylinder Viertakt-Kreuzkopfmotoren ohne Übersetzungsgetriebe, jeder direkt auf eine Schraube wirkend, nach denen sich wohl heute jedes Schifffahrtsmuseum die Finger lecken würde. Eine außen liegende Nockenwelle mit je vier Nocken pro Zylinder für Ein-, Auslass- und Anlassventil und Einspritzdüse. Die Brennstoffeinspritzung er-folgte über Archaloff-Pumpen. Diese wurden von einem Gaskolben, mit dem Kompres-sionsdruck des Zylinders angetrieben, der den Plunger der Einspritzpumpe bewegt. Jeder Motor hatte 950 PS bei einer Drehzahl von etwa 140 U/min. Auf heutigen Schif-fen ist das die Leistung eines Mittelschnellläufers zur Stromerzeugung. Die Dinger hat-ten eine beachtliche Größe, ca. 10 Meter lang und auf drei Stationen etwa 6 Meter hoch. In dieser Größe baut man heute Schiffsdiesel mit mehr als der zehnfachen Leistung. Noch heute erfüllt es mich mit Ehrfurcht, dass man schon 1915 imstande war solche Maschinen zu bauen. Man bedenke, dass Rudolf Diesel den Ölmotor - so nannte er ihn damals - 1898 entwickelte, und dieser erstmals 1908 zum Einsatz kam.
Der Schiffsrumpf der MÜLHEIM-RUHR bestand aus genieteten, meiner Erinnerung nach ca. 30 bis 40 mm dicken, Stahlplatten. Keine erhöhte Back und Poop. Im Vorschiff vier Ladeluken und eine achtern. Die Mittschiffsaufbauten bestanden aus nur zwei Decks im hinteren Drittel des Schiffes. Die Offiziere und wir Assistenten wohnten mittschiffs auf dem Hauptdeck, die Mannschaften im Deckshaus achtern, teils über, teils unter Deck. Die 3 Masten waren leicht nach achtern geneigt, wie man es von Se-gelschiffen kennt. Ebenfalls unglaublich, aber es waren tatsächlich Segel vorhanden, die aber während meiner Zeit an Bord nicht zum Einsatz kamen.
Die erste Reise ging nach Alexandria in Ägypten, wo wir Weihnachten lagen. In den Messen wurden, die im Kühlraum mitgenommen, Tannenbäume aufgestellt. Mein erstes Weihnachten unter südlicher Sonne. Es kam keine besondere Weihnachtsstimmung auf. In der Heizermesse kam es zu einem Besäufnis und unsere 5 Reiniger bombardierten anschließend den Tannenbaum mit Bierflaschen. Es waren alles kräftige Kerle, die offensichtlich mit ihrer Arbeit nicht ausgelastet waren. Gegen Mitternacht warfen sie einen Scherstock außenbords. Das Ding wog wohl mehr als eine halbe Tonne. Besonders einer dieser rauen Burschen ist mir noch gut in Erinnerung. Er zog einen Expander mehrfach vorne mit beiden Armen auseinander, den ich, der ich auch nicht gerade schwächlich war, nur ein paar Zentimeter auseinander ziehen konnte.
Die Saufgelage dieser Burschen waren gefürchtet, und man hielt sich dann tunlichst nicht in ihrer Nähe auf. Selbst der Kapitän schloss sich in seiner Kammer ein, wenn die Brüder mal wieder tagten. Solange sie nüchtern waren, konnte man gut mit ihnen auskommen. Einige von ihnen hatten schon im Knast gesessen und prahlten mit ihren Erlebnissen.
Mit einigen Leuten stürzten wir uns in das Nachtleben von Alexandria. Zu meiner Überraschung konnte man überall in den Bars Alkohol bekommen. Mit einem Fiaker fuhr ich zusammen mit dem Bäcker durch die nächtliche Stadt zurück an Bord.
Tagsüber fielen Dutzende von Händlern über das Schiff her und versuchten uns ihre Waren zu verkaufen. Einer der Matrosen hatte aus unerfindlichen Gründen einige Hühnerküken erworben. Die liefen auf der Back in der Matrosenmesse herum und fie-len in die heißen Suppenteller. In das Alter zum Eierlegen kam keines von ihnen.

Mein Kammerkollege Jens in Alexandria
|
Die zweite Reise sollte mir zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.
In Rotterdam wechselte der 3. Ing. An Bord kam der 3. Ing., den ich schon von der BARBARA her kannte.
Von Rotterdam ging es in Ballast nach Safi in Marokko, wo Phosphat für Cochin in Indien geladen werden sollte. Schon im englischen Kanal machte uns das schlechte Wetter zu schaffen. Die ständige Schaukelei war sehr hinderlich bei der Arbeit, wie man sich mit einer Hand ständig festhalten musste, sonst konnte es passieren, dass man quer durch den Maschinenraum geschleudert wurde. Prellungen und evtl. Knochenbrüche konnten die Folge sein. Nicht nur auf Segelschiffen gilt: "One hand for you and one for the ship!"
Auf meiner Wache war ich damit beschäftigt Einspritzdüsen zu überholen. Ich spannte den schweren Düsenkörper zusammen mit einem Reiniger in die Abspritzvor-richtung und schloss die Leitung an die Handpumpe an. Der Reiniger musste sich mit seinem ganzen Körpergewicht auf den Pumpenhebel stemmen. Ein unter die Düse gehaltenes Stück weißes Papier zeigt, ob die sternförmig angebrachten 8 bis 10 Dü-senbohrungen auch gleichmäßig abspritzten. Ich hatte wohl gerade meinen Finger unter der Düse, als sich mein Gehilfe wieder auf den Pumpenhebel stemmte, so dass mir der nadelfeine Strahl mit 400 bar in die Kuppe des linken Zeigefingers stach.
Der Finger schwoll in den nächsten Stunden auf doppelte Dicke an und ein pochen-der Schmerz raubte mir den Schlaf. Ich wurde von der Wache befreit. Um den Schmerz zu betäuben trank ich eine halbe Flasche Cognac und legte mich in die Koje. Ich muss wohl im Delirium Tremens gewesen sein, denn als ich am nächsten Morgen erwachte, hatte ich mich erbrochen und lag in meiner eigenen Kotze. Es stank bestialisch. Mein Kammergenosse Uwe Bahnsen staunte nicht schlecht, als er die halb leere Flasche Cognac sah, wobei noch eine Spur Bewunderung mitschwang ob meines Al-koholkonsums.
Inzwischen hatten wir die Biscaya erreicht und die Herbststürme packten uns mit voller Gewalt. Windstärken um 10 brachten das in Ballast laufende Schiff zum tanzen und bedingt durch die geringe Maschinenleistung kaum von der Stelle.
Der 2. Offizier, der an Bord üblicherweise die Apotheke unter sich hat und als Sani-täter fungiert, sah sich meinen bedrohlich angeschwollenen Finger an. Es bestand die Gefahr, dass das eingespritzte Dieselöl in den Blutkreislauf kam. Wahrscheinlich war ich, ohne mir dessen bewusst zu sein, in Lebensgefahr. Also wurde beschlossen den Finger aufzuschneiden. Die Lotsenkammer an Steuerbord wurde zum Operationssaal auserkoren. Es befanden sich drei Skalpells in der Bordapotheke, eines war angerostet, die anderen beiden stumpf. Nach längerer Diskussion entschieden wir uns für eines der stumpfen Skalpells. Dieses wurde auf einem Spirituskocher zusammen mit einer Spritze in kochendem Wasser steril gemacht. Außer dem "Doktor" und mir mussten noch drei Mann mithelfen. Einer hielt wegen der Schaukelei den Stuhl des Operateurs, einer meinen Stuhl, und der dritte den Spirituskocher fest. Sonst wäre alles über Stag gegangen.
Als erstes jagte der 2. Off. drei Betäubungsspritzen in den Finger. Nach kurzer Zeit hatte ich kein Gefühl mehr darin. Dann setzte er das etwas stumpfe Skalpell an. Die durch die Schwellung ohnehin gespannte Haut drückte sich kurz ein und spaltete sich dann gleich bis zum Knochen auf. Interessiert betrachtete ich meinen aufgeschnittenen Finger und den elfenbeinfarbenen Knochen. Der 2. Off. kriegte es plötzlich mit der Angst:: "In dem Finger werden Sie nie wieder Gefühl haben!" Er wurde sichtlich nervös. Es war wohl seine erste Operation - übrigens meine auch.
Von dem eingespritzten Dieselöl war leider nichts zu sehen. Schnell wickelte er mit einem Verband die auseinander klaffende Schnittwunde wieder zusammen und gab mir noch eine Schlinge, um den Arm ruhig zu halten.
Operation misslungen - Patient lebt noch!

Patient nach der OP
|
Inzwischen hatten wir Kurs geändert, um einen Hafen anzulaufen. Allerdings nicht meinetwegen, soviel Fürsorge konnte ich nicht erwarten. Das Wetter ließ uns keine andere Wahl. Vor Falmouth in Cornwall, Südengland gingen wir auf geschützter Reede vor Anker. Mit dem Lotsenboot wurde ich an Land gebracht, und der Agent fuhr mich ins Krankenhaus.
Die Ambulanz war ein großer, durch eine Glaswand getrennter Raum. Auf der einen Seite warteten etwa ein Dutzend Patienten, Frauen, Männer und ein paar Kinder und auf der anderen Seite hatten drei Ärzte ihren Platz zum Behandeln. Alles vor den Augen der wartenden Patienten. Ich fand es etwas merkwürdig, dass manche sich vor aller Augen halb ausziehen mussten, aber kaum einer der Wartenden nahm Notiz davon. Eine Ärztin sah sich meinen lädierten Finger kurz an und befahl: "Put down your trousers!" Ich sah mich um. Sollte ich etwa vor allen Leuten die Hosen runter lassen? Als sie mein Zögern bemerkte, packte sie ein Kissen auf eine Trage zum Abstützen. Für Bequemlichkeit wurde wenigstens gesorgt! Ich ließ also meine Hose herunter, stützte mich auf der Trage ab. und streckte den nackten Hintern dem Zuschauerraum entgegen. Dann gab sie mir eine Spritze in den Hintern.
"Penicillin!"sagte sie.
"How many units", fragte ich.
"One Million", war die Antwort.
Dann erzählte sie mir noch, dass ein anderer German seaman hier im Krankenhaus liege, ob ich ihn nicht besuchen möchte. Er spräche kein Englisch.
Eine Schwester führte mich in einen großen, langen Krankensaal. Auf jeder Seite standen an die zwanzig Betten. Um jedes Bett waren Vorhänge an der Decke befestigt. Sie zog den Vorhang um das Bett des Seemanns herum. Ich fand das einen Witz. In der Ambulanz wurde keine Rücksicht auf Schamgefühl genommen und hier tat man so als ob ich mit meiner Liebsten schmusen wollte.
Der junge Seemann war gerade erst aus der Narkose erwacht und noch etwas bedudelt. Er hatte sich den Handteller in einer Maschine durchstoßen.
Inzwischen war es Abend geworden und der Agent brachte mich in einer Pension unter. Die Wirtin begrüßte mich mit einer Tasse Tee. Während ich das heiße Getränk schlürfte sprach sie davon, dass der Krieg nur von den Großen gemacht würde, die kleinen Leute wären nur die Leidtragenden. Damals habe ich nicht viel darüber nach-gedacht. Erst heute ist mir die Bedeutung ihrer Worte wirklich bewusst. Damals, im Jahre 1957 war die Erinnerung an den 2. Weltkrieg noch allgegenwärtig.
Abends saß ich mit den anderen Pensionsgästen im Aufenthaltsraum und sah fern. Gezeigt wurde ein Interview mit den Überlebenden des deutschen Segelschulschiffes PAMIR; das am 21. September 1957 im Atlantik gesunken war. Die Jungs rekonstruier-ten in fließendem englisch an einem Modell im Wasserbecken die Havarie des Groß-seglers.
Am nächsten Morgen wurde ich von der Wirtin mit einer Tasse Tee geweckt, die mir ans Bett gestellt wurde. "Das ist England", dachte ich.
Das Lotsenboot brachte mich am nächsten Mittag zurück an Bord. Der Sturm war abgeflaut. "Denn wollen wir es mal wieder versuchen", meinte unser Kapitän. Er kam wohl von der Agentur, wo er mit der Reederei telefoniert hatte.
Im zweiten Anlauf schafften wir die Biskaya und es wurde bald wärmer. In Safi nahmen wir Ladung. Das ganze Schiff war eingestaubt von dem Phosphat, der lose in die Luken geschüttet wurde. Das Zeug sah aus wie Wüstensand.

Beim Phosphat laden in Safi
|

in Safi
|

Casablanca
|
Dann begann die Reise. Etwa 45 Tage Seetörn lagen vor uns bis Indien. Durch die Straße von Gibraltar und gleich um die Ecke zum Bunkern in Ceuta. Da das Bunkern sich den ganzen Tag hinzog hatten wir Gelegenheit an Land zu gehen. Mit Alfred, genannt Alfi, meinem anderen Assi-Kollegen zog ich durch die Souks. Wir kamen uns vor wie in Tausendundeiner Nacht. Die engen steilen Gassen, das orientalische Treiben - es war eine andere Welt. Ich sah so etwas das erste Mal.
Der eintönige Seetörn begann. Ich ging die 4 - 8 Wache mit dem 2. Ing. Wagner. Nach der Abnahme der Wache morgens um vier Uhr ging ich erst einmal Kaffee ko-chen. Wenn man nachts die Pantry betrat, waren die Wände schwarz von Kakerlaken. Ich wischte mit dem Arm über die Wand am Ausguss und die Viecher prasselten zu Hunderten herunter. Mit heißem Wasser spülte ich einen Teil von ihnen weg. Man konnte sie auch prima für Kakerlakenrennen benutzen. Jeder hatte seine Rennkakerlake in einer "Three Torches"- Streichholzschachtel. Über die Back wurden mit Gasöl getränkte Bindfäden als Bahnen gespannt. Dann ging das Rennen los. Natürlich nur gleich große gegeneinander wegen der Fairness . Wessen Kakerlake zuerst am Ziel war hatte gewonnen; der Besitzer der Letzten musste eine Rund Bier bezahlen.
Der 2. Ing. Wagner, war ein kleiner drahtiger Mittvierziger. Er war für seine Döntjes berühmt. Stundenlang konnte er sich in epischer Breite über seine sexuellen Erlebnisse auslassen, die wahrscheinlich alle nur in seiner Phantasie existierten. Trotzdem hörten wir immer gespannt zu - man hat ja sonst keine Abwechslung. Die Flasche Bier gehörte zu ihm wie das Zepter zum König.
Die Wache über saß er in der Nähe des einzigen funktionierenden Lüfters auf dem Indikatorkasten, rauchte eine Zigarette, Marke Chesterfield, nach der anderen und nahm ab und zu einen Schluck aus der Bierflasche. Er war ein angenehmer Vorgesetz-ter, der kaum einmal auf Wache was sagte und froh war, wenn man seinen Wachdienst machte. Außerdem wurde für jede Wache noch ein Reiniger eingeteilt, der im stündlichen Rhythmus die Nockenwellenlager abschmierte. Ich drehte meine Runden, notierte Drücke und Temperaturen und führte das Journal. Es wurde langsam wärmer. Dabei waren wir noch im Mittelmeer. In Rotsee (Seemannsausdruck für Rotes Meer) und im indischen Ozean stand uns noch einiges bevor.
Nach etwa 10 Tagen und 1900 Seemeilen weiter westlich, erreichten wir den Suez-kanal. In Port Said kam mit dem Kanallotsen eine ganze Gang von Festmachern mit an Bord. Die brachten gleich ihre Handelsware an Souvenirs mit. Anscheinend hatte jeder damit noch einen Nebenverdienst. Arabische Sitzkissen, Kamelhocker, Decken usw. wurden auf dem Achterdeck aufgebaut. Auch ich erstand so ein rundes Sitzkissen aus Leder. Die Händler / Festmacher wieselten durchs ganze Schiff. Alle Räume mussten abgeschlossen werden, sonst verschwand alles was nicht niet- und nagelfest war.

Blick achteraus im Suezkanal
|
Man konnte auch mit Naturalien zahlen. Besonders begehrt war Seife und - Bier! Auf unseren Hinweis, dass Allah doch Alkohol verboten habe, hieß es nur: "Mach Tür zu - Allah sieht nicht"!
Das Schiff wurde für die Passage präpariert. Am Vorsteven wurde der Suezkanal-scheinwerfer installiert. Ein Kasten mit etlichen Lampen für die Nachtfahrt. Im großen Bittersee gingen wir für ein paar Stunden vor Anker. Hier sollten später nach dem Suezkrieg etliche Schiffe für mehrere Jahre festliegen.
Die Stadt Suez, die dem Kanal den Namen gab, liegt am südlichen Ende des 171 Kilometer langen Kanals und mündet in den Golf von Suez, der in das Rote Meer übergeht. Der Suezkanal hat im Unterschied zu den meisten anderen Kanälen keine Schleusen.

Das südliche Ende des Suezkanals
|
Es wurde erheblich wärmer. Die Hitze im Maschinenraum wurde schier unerträglich. Gleich beim Auslaufen in Rotterdam war einer der beiden elektrischen Lüfter ausgefal-len und es war kein Ersatzmotor an Bord. Das Brassen der Windhutzen brachte kaum Kühlung. Wenn Wind und Schiffsgeschwindigkeit identisch sind und der Wind genau von achtern kommt, ist der Effekt gleich null. Am Manöverstand maß ich 55°C. Probe-weise nahm ich das Thermometer mal mit auf die Zylinderstation. Hier zeigte es 75°C an. Die metallenen Handläufe der Geländer konnte man nur noch mit Handschuhen oder um die Hände gewickelten Putzlappen anfassen, sonst gab es Brandblasen. Die Kühlwassertemperaturen stiegen in bedenkliche Höhen.
Im Gegensatz zu neuen Schiffen hatten wir keine Frischwasserrückkühlung, son-dern die Maschinen wurden direkt mit Seewasser gekühlt. Mit beiden Kühlwasserpum-pen konnten wir gerade noch die Temperatur halten. Das Meerwasser hatte hier fast 35°C.
Das Schiff war für den Tropeneinsatz gebaut worden. Alle Kammertüren gingen nach außen zum Betriebsgang auf, so dass man sein Schott bei gutem Wetter offen lassen konnte um etwas Luft in die stickigen Räume zu bekommen. Trotzdem war an erholsamen Schlaf nicht zu denken. Nach kurzer Zeit war das Bettlaken durchge-schwitzt, das Kopfkissen konnte man auswringen. Die einzige Abkühlung brachte der Ventilator, Miefquäler genannt, der einem auf den schweißnassen Leib blies. Spätfolgen an Rheuma waren vorprogrammiert.
Auch das Rasieren mit einem Elektrorasierer, war nur direkt vor dem Ventilator möglich. Wenn der Schweiß in Strömen übers Gesicht läuft, rutscht der E-Rasierer nur noch über die nassen Bartstoppeln. Besser ist dann doch eine Nassrasur.

Der Junge an der Reling
|
In irgendeinem Hafen hatte jemand ein Fahrrad an Bord gebracht, wahrscheinlich geklaut. Auf unserem langen Vordeck konnte man damit bei ruhiger See vorzüglich radeln. So gondelte ein Matrose mit dem Rad längs des Betriebsganges als gerade der Chief aus seiner Kammer heraustrat. Die Kollision war unvermeidlich. Beide gingen Parterre. Der cholerische Alte, den wir unter uns nur Opa nannten, nahm das Fahrrad und schleuderte es im hohen Bogen außenbords. Jetzt liegt es irgendwo im roten Meer, querab Dschidda. Die Geschichte von Opa's "Verkehrsunfall" machte schnell die Runde.
Schon seit einigen Tagen pfiff ein Anlassventil der Backbordmaschine. Es half nichts, der Rezess war undicht. Der Zylinderdeckel musste gewechselt werden. Und das bei 75°C auf der Station. Die Maschine wurde gestoppt und wir schipperten nur mit der Steuerbordmaschine weiter. Immerhin ein Vorteil, wenn zwei unabhängig vonei-nander laufende Antriebsmaschinen vorhanden sind.
Es wurden Gruppen von 3 Mann gebildet, die jeweils ca. 15 Minuten arbeiteten und dann von der nächsten Gruppe abgelöst wurden. Länger konnte man es bei diesen Temperaturen nicht aushalten.
Nach dem Frühstück begannen wir. Als erstes musste der Deckel abgetakelt wer-den. Alle Verschraubungen für Brennstoff, Kühlwasser, Ansaug- und Abgaskanal wur-den entfernt. Dann begann das Losschlagen der Deckelmuttern. Der Deckel ist mit ca. 20 solcher Muttern, Größe etwa M 80, befestigt. Die Schlüsselweite beträgt ca. 150 mm. Ein Schlagschlüssel wird aufgesetzt und dann mit dem Vorschlaghammer, Moker genannt, aufgeschlagen. Dazu braucht man erst mal an die zehn Schläge, bevor die Mutter sich überhaupt rührt. Nach 10 Schlägen ist man aber so fix und fertig, dass ei-nem der schwere Hammer fast aus der Hand fällt. Der Schweiß rinnt in Strömen. Damit er mir nicht dauernd in die Augen läuft, hatte ich mir ein Schweißtuch um die Stirn gebunden.
Ich hatte gerade meine 10 Schläge hinter mir und lehnte erschöpft am Geländer. Mein Kollege Jens war am Schlagen. Ich merkte wie er den schweren Vorschlagham-mer kaum noch hoch bekam. Plötzlich glitt er ihm aus den Händen. "Ich kann nicht mehr", murmelte er "ich glaub ich kipp gleich --uuummm"! Das "um" bekam er kaum noch heraus, dabei drehte er sich halb um die eigene Achse und sackte zusammen. Ich konnte ihn gerade noch auffangen. Zusammen mit dem Reiniger schleppten wir den halb Bewusstlosen den Niedergang hoch. An Deck legten wir ihn auf die Luke. Ich konnte mich gleich daneben legen - ich sah nur noch Sterne.
Nach einem Tag harter Arbeit hatten wir es geschafft. Der etwa eine Tonne wiegen-de Deckel (beim Auto nennt man es Zylinderkopf) war ausgewechselt. Wir konnten wieder volle Fahrt mit beiden Maschinen machen.
Volle Fahrt hört sich gut an. Unsere Geschwindigkeit betrug kaum 8 Knoten. Ein Etmal (Weg des Schiffes in 24 Stunden, von 12 Uhr mittags bis 12 Uhr mittags) von 185 Meilen war schon nahezu Spitze. Mehr gaben die altersschwachen Maschinen nicht her. Durch die vielen Stopps wegen der Reparaturen konnten wir selbst die 185 Meilen oft nicht einhalten. Aber mit Wind und Strom von Achtern und Mond von vorne schafften wir es dann doch. Für diejenigen, die es nicht wissen: Der Mond ist magne-tisch und zieht das eiserne Schiff an - jedenfalls wird das behauptet ...??
Etwa in der Mitte des Weges im Roten Meer ging ein Heuschreckenschwarm über das Schiff hinweg. Das Deck war zentimeterhoch von Heuschrecken bedeckt. Mit dem Deckwaschschlauch spülten die Matrosen sie von Bord. Einer meiner lieben Kollegen hatte mir eine Heuschrecke in meine Freiwachschuhe getan. Als ich mich nach der Wache umzog, hatte ich plötzlich so ein Kribbeln unter der Fußsohle. Die Dinger sind mehrere Zentimeter lang.
In Aden, an der Südspitze Arabiens, war wieder Bunkern angesagt. Alle Bunker wurden mit Gasöl (Dieselöl) gefüllt, denn nun lag das Arabische Meer, so heißt dieser Abschnitt des Indischen Ozeans, vor uns. 1850 Seemeilen trennten uns noch von un-serem Zielhafen Cochin.
Das Wetter war ruhig. Die See manchmal spiegelblank wie auf der Alster. Riesige Schwärme von fliegenden Fischen glitten über die Oberfläche. Manchmal kam es vor, dass einer nachts, angelockt durch ein helles geöffnetes Bullauge, an Bord landete. Ein Matrose weidete den Fisch aus und stopfte ihn mit Tabak voll. Der Tabak sollte eine konservierende Wirkung haben. Trotzdem stank das Tier nach kurzer Zeit penetrant nach vergammeltem Fisch.
Manchmal ging ich im Dunkeln zum Vorschiff und schaute zur Bugwelle hinunter. Es leuchtete wie tausend kleiner Lampen. Es sind Kleinstlebewesen, die in der aufschäu-menden Bugwelle zum Leuchten gebracht werden, bekannt als Meeresleuchten. Stun-denlang hätte ich auf dem Rücken liegend den Sternenhimmel betrachten können. Die Sterne wirkten hier in den Tropen irgendwie näher als zu Hause. Sternschnuppen sieht man in großer Zahl. Leider nahte die nächste Wache und ich brauchte noch eine Mütze voll Schlaf.
Auf so einem langen Seetörn ist es manchmal recht langweilig. Ich bediente mich ausgiebig in der Bordbibliothek. Unter anderem las ich ein Buch von Clairenore Stinnes, einer Tochter des Firmengründers. "Im Auto durch zwei Welten" hieß es nach meiner Erinnerung. Sie beschrieb, wie sie in den 20er Jahren zusammen mit einem Journalisten im Auto über den Balkan nach Asien und von dort per Schiff nach Süd-amerika fuhr. Eine abenteuerliche Reise, wenn man bedenkt, dass damals weder die Autos noch die Straßen unseren heutigen Vorstellungen entsprachen.
Als ich die nicht gerade umfangreiche Bordbibliothek durch hatte, nahm ich mir die auf jedem Schiff vorhandenen Erste-Hilfe-Bücher vor. Diese, extra für Seeschiffe auf-gelegten Bücher, behandeln vor allem die Krankheiten, die besonders in heißen tropi-schen Gefilden vorkommen, einschließlich der Geschlechtskrankheiten. Wahrschein-lich geht es jedem nicht medizinisch geschulten so wie mir: Beim Lesen glaubt man unwillkürlich die Symptome an sich selbst zu entdecken. Natürlich ist alles Einbildung! Außer Hitzepickeln, besonders unter den Achseln, die wir "Roten Hund" nannten hatte ich nichts.
Nach meiner Wache saß ich abends mit den andern auf der Achterdeckluke und es wurde über Gott und die Welt geredet. Jeder mit der unvermeidlichen Bierflasche in der Hand. Der Blick schweifte hinaus übers Meer. Die Sonnenuntergänge in den Tropen sind faszinierend. Natürlich muss viel getrunken werden. Die paar Tassen Kaffee zum Frühstück und der Tee zum Abendbrot sind nicht ausreichend. Gelegentlich machte der Koch eine ganze Milchkanne voll "Kujambelwasser", so nennt man an Bord Fruchtsirup mit Wasser. Die kanne wurde eine Nacht im Kühlraum aufbewahrt und dann noch Eis hinzugefügt. Man konnte sich tot trinken an dem süßen Zeug. Ansonsten waren wir auf unser Freilager angewiesen, dessen Verkauf der Steward unter sich hatte. Jede Limo musste teuer bezahlt werden.
Ab und zu musste auch mal Zeugwäsche gemacht werden. Eine Waschmaschine gab es erst viel später an Bord von modernen Neubauten. Die Klamotten wurden in einer Pütz eingeweicht, und wenn nötig, auf einer Heizplatte gekocht. Bei dem Arbeits-zeug machte ich es mir etwas leichter. Nach der Wache stellte ich mich, durchge-schwitzt wie ich war, einfach damit unter die Dusche. Anschließend wurden die Sachen ausgewrungen und oben im Maschinenraum übers Geländer gehängt. Zur nächsten Wache waren sie wieder trocken.
Endlich erreichten wir Cochin. Eine Hafenstadt am südlichem Teil der Westküste des indischen Subkontinents.
Eine indische Ärztin kam an Bord und wir wurden alle geimpft. Sie war klein und zierlich in einem landesüblichen Sari gewandet. Einige unserer Leute waren so groß, dass sie auf einen Stuhl steigen musste um an den Oberarm heranzukommen.
Das Löschen unserer Phosphatladung dauerte fast 14 Tage. Wir lagen im Strom an den Pfählen. Die Ladung wurde mit eigenem Geschirr gelöscht. In Stahlnetze wurden Planen gelegt und im Laderaum von den Hafenarbeitern (um nicht das böse Wort Kuli zu gebrauchen) von Hand voll geschaufelt. Der Hiev wurde in einen der Lanchen ver-laden, die beidseitig längsseits festgemacht hatten.
Wir gingen Hafenwache, so dass ich viel Gelegenheit hatte an Land zu kommen. Einheimische boten uns für ein paar Rupien das Übersetzen an Land an. Die Einheimi-schen, die das Schiff löschten wurden von Land mit Essen versorgt. Jeder bekam eine in Palmblättern eingerollte Portion Reis mit Curry. Unser Koch, neugierig wie das wohl schmeckt, ließ sich etwas davon zum Probieren geben. Anschließend führte er einen wahren Indianertanz an Deck auf. Wild mit den Armen rudernd schrie er: "Mein Gott, ist das scharf - ist das schaaaaaarf !" Indisches Essen ist nicht gerade für europäische Gaumen geeignet.
Einmal wanderte ich mit einem Matrosen fast den ganzen Tag durch die Stadt. Ein Junge bot uns seine Führung an und zeigte uns die Sehenswürdigkeiten. Er trug die landesübliche Kleidung. Ein weißes Tuch um die Hüften geschlungen, das manchmal wie ein Rock getragen wurde, manchmal aber zwischen den Beinen hochgeschlagen wie ein Pumphose aussah. Darüber trug er ein ebenfalls weißes Hemd das offen bis zu den Hüften reichte.
Wir durchstreiften viele enge Straßen in denen sich das Leben abspielte. Fliegende Händler, die ihre Waren im Gewirr der Menschen anboten; und dazwischen heilige Kü-he, die herrenlos herumliefen und sich an den angebotenen Gemüse gütlich taten. Keiner verjagte sie, es wurde nur vorsichtig die Ware in Sicherheit gebracht.
Scharen von bettelnden Kindern umschwärmten uns, die uns den ganzen Weg unter ständigen Rufen: "Bakschisch, Bakschisch!", oder "one Ana, one Ana!", folgten. Ein kleiner Junge hielt mir seinen Arm unter die Nase. Der dünne Unterarm war in der Mitte fast rechtwinklig verbogen. Ich hatte schon davon gehört, dass Kinder in Indien ver-stümmelt werden, damit sie beim Betteln Mitleid erregen. Um der lästigen Schar zu entkommen, betraten wir ein kleines Restaurant.
Seine Höflichkeit gestattete unserem Guide nicht, sich zu uns an den Tisch zu set-zen, obwohl wir ihn mehrfach dazu aufforderten. Er nahm an einem Nebentisch Platz. Wenigstens ein Getränk durften wir ihm spendieren.
Als wir das Restaurant verließen, wartete bereits die bettelnde Kinderschar auf uns. Wir warfen eine Handvoll Münzen in die Menge und rannten davon. Die Kinder balgten sich um die im Straßenstaub liegenden Münzen und wir waren sie endlich los.
Der Guide führte uns zu einem Tempel, der von einem breiten Wassergraben umgeben war. Auf einem Altar lag eine tote Schlange, wohl ein Opfer für die heimische Gottheit.

Straßenbild In Cochin
|
Ich machte ein Foto davon. Auch von einem kleinen Schulmädchen mit der Schiefertafel in der Hand. Mit Bindfaden waren Griffel und Schwämmchen an der Tafel befestigt.
Mehrere Male fuhren wir auch mit einem Taxi in ein außerhalb gelegenes, im Stil der englischen Kolonialzeit gebautes Hotel am Meer, wo wir im Garten unter Palmen sitzend uns ein kühles Bier schmecken ließen. Es war warm. Schließlich befanden wir uns etwa auf dem 10 Breitengrad, (genau 9° 58'N) ca. 1100 km nördlich des Äquators. Das Bier, abgefüllt in Halbliterflaschen, trug ein Etikett mit der Aufschrift: "Sankt Pauli Girl" und der Abbildung eines mit bunten Bändern gekleideten tanzenden Mädchens. So stellte man sich hier wohl die Schönen von der Reeperbahn vor.
Da saßen wir nun in südlichen Gefilden und ein Matrose sinnierte: "Andere müssen viel Geld dafür ausgeben um hierher zu reisen, wir werden sogar noch bezahlt!" So kann man es auch sehen.
Zum Hotel gehörte auch ein Pool, den wir ausgiebig nutzten. Auch davon habe ich noch Fotos.
Ein anderes mal mieteten wir uns für umgerechnet ein paar Mark ein Taxi für den ganzen Tag und ließen uns vom Fahrer in der Gegend herumfahren. So sahen wir mal etwas mehr von der Gegend als nur den Hafen.

In Cochin
|
Von Mitternacht bis morgens ging meine Hafenwache und da ich manchmal den ganzen Tag an Land verbrachte, kam ich wenig zum Schlafen. Auch nachts wurde gelöscht. Manchmal konnte es passieren, dass, wenn mehrere der Elektrowinden gleichzeitig anliefen, der Überstromabschalter ansprach und der Strom ausfiel. Dann rannte ich zur Schalttafel legte den Hauptschalter wieder ein und ließ die Kühlwasser-pumpe wieder an. Sonst gab es wenig zu tun. Acht Stunden Wache können ganz schön lang sein, besonders wenn man gegen die Müdigkeit anzukämpfen hat. Nach dem Motto: "Ein guter Wachmann hat morgens gut ausgeschlafen", legte ich mich manchmal neben den Hilfsdiesel auf ein paar Rappeltücher um ein kurzes Nickerchen zu machen. Mein Gedanke war: Wenn der Diesel durch Stromausfall ohne Last läuft hat er einen andern Klang und davon würde ich schon aufwachen.

Zum Hotel gehörte auch ein Pool, den wir ausgiebig nutzten
|
Das klappte auch prima, bis ich irgendwann an Deck auf einem Lukendeckel ein-schlief und unsanft durch einen Fußtritt des Chiefs geweckt wurde. Der Strom war ausgefallen, und Opa, mit seinem leichten Schlaf, hatte gemerkt, dass die Kühlwasser-pumpe nicht mehr lief. Der direkt unterhalb seiner Kammer nicht mehr plätschernde Ausguss hatte ihn wach werden lassen. Daraufhin durfte ich keine Nachtwachen mehr gehen und musste in den Tagesdienst von morgens acht bis vier Uhr nachmittags. Das kam mir auch gar nicht so ungelegen. Dadurch hatte ich wenigstens die Abende Zeit zum Landgang.
Unser nächster Hafen sollte Marmagao im Bundesstaat Goa sein - damals noch portugiesische Kolonie. Er liegt ungefähr in der Mitte der Westküste Indiens und gilt als einer der besten Naturhäfen des Landes. Dort sollten wir eine Ladung Erz für Rouen in Frankreich laden.
Mit meinen Kollegen nutzte ich jede Möglichkeit an Land zu gehen. Wir schwammen im warmen Wasser des indischen Ozeans und aalten uns am Strand unter Palmen. Besonders die Matrosen waren braungebrannt wie die Inder. Sie waren ja ohnehin durch ihren Job immer an Deck. Bei solchen Gelegenheiten kam mir manchmal der Gedanke, ob ich nicht doch besser die nautische Laufbahn eingeschlagen hätte. Später, in kalten skandinavischen Wintern, war ich wieder froh, meinen Arbeitsplatz in der war-men Maschine zu haben.

Unser Boot brachte uns an Land
|
Auf der Rückreise wurde das Trinkwasser rationiert. Aus mir nicht ersichtlichen Gründen konnten wir in Marmagao kein Trinkwasser bunkern. Die Frischwasserpumpe wurde nur noch zu den Wachwechseln eingeschaltet, damit die durchschwitzten Leute sich wenigstens mit Frischwasser duschen konnten. Normale Seife ist bei Seewasser nicht zu gebrauchen. Natürlich bekam die Kombüse weiter ihr Wasser zum Kochen. Die Frischwasserrationierung wurde allerdings noch als das kleinere Übel angesehen. Viel schlimmer war, dass der Biervorrat zur Neige ging.
Auf dem Vordeck wurde ein Swimmingpool errichtet. Aus Balken und Brettern ent-stand ein Gerüst, das mit einer Persenning ausgelegt wurde. So entstand ein Becken von ca. 3 mal 3 Metern in das Seewasser gepumpt wurde. Das Wasser war hüfthoch - freischwimmen konnte man sich darin nicht. Ich ging inzwischen die 12 bis 4 Wache. Gleich bei Wachende stürzten wir uns in das Becken und genossen das "kühle", 35°C warme Wasser. Nach den Temperaturen im Maschinenraum empfand man es gerade-zu als erfrischend. Besonders schön war es morgens um vier, wenn unsere Wache beendet war unter dem südlichen Sternenhimmel im Wasser zu plätschern.

Unser selbst gebauter Swimmingpool an Deck
|
Nur eine geringe Bewegung reichte schon um auch in unserem Schwimmbecken das Meeresleuchten zu erzeugen.
Nach mehreren Wochen Seetörn, wieder durch den Suez, durchs Mittelmeer, die Straße von Gibraltar, an der Küste der iberischen Halbinsel nordwärts, diesmal durch die ruhige Biscaya erreichten wir den englische Kanal. In Le Havre machten wir fest um den Flusslotsen an Bord zu nehmen. Es dauerte einige Stunden bis der Lotse an Bord kam und so hatte ich Gelegenheit kurz an Land zu gehen. Auf meinem Bummel durch die Stadt sah ich einige unserer Reiniger, die ziemlich angetrunken und in ihren dreckigen Arbeitsklamotten, mitten auf der Straße randalierten. Schnell, bevor sie mich entdeckten, entfernte ich mich.
Die Revierfahrt durch die liebliche Landschaft des Seinetales war wunderschön. Es war inzwischen Mai und alles strahlte im frischen Grün. In Rouen machten wir etwas außerhalb am Hochofenwerk fest. Nach dem Abendbrot nahmen wir uns zu dritt ein Taxi in die Stadt, und bummelten durch das abendliche Rouen. Die Straßen waren fast menschenleer, welch ein Kontrast zu den von Leben erfüllten Straßen in indischen und nordafrikanischen Städten.
Da das Gerücht umging, die nächste Reise würde wieder nach Indien gehen, mus-terte ich in Rouen ab. Da ich genau sechs Monate an Bord war bekam ich eine freie Heimreise von der Reederei bezahlt.
Die Fahrkarte für die Bahnfahrt besorgte die Agentur. In Paris wurde umgestiegen in den Schnellzug nach Hamburg. Dazu musste ich in 20 Minuten von einem Bahnhof zum anderen, den Gar du Nord fahren. Dem Taxifahrer versprach ich 1000 alte Franks, wenn er es schaffen würde. Und er schaffte es, in einem Affenzahn, schlängelte er sich durch den Verkehr. Nach einer Nachtfahrt war ich spät abends in Hamburg. Umsteigen in den Zug nach Lübeck und ich war wieder zu Hause.
Sechs interessante und ereignisreiche Monate lagen hinter mir.
Epilog
Noch heute, nach so langer Zeit, befällt mich eine gewisse Wehmut, während ich diese Zeilen schreibe. Die "Mülheim-Ruhr" war für sechs Monate meines Lebens Heimat für mich gewesen.
Wie mir heute bekannt ist, gab es keine zweite Indienreise. Die MÜLHEIM RUHR wurde am 23.06.1958, drei Wochen nach meiner Abmusterung, in Hamburg aufgelegt. Zehn Monate später am 23.04.1959 wurde sie zum Abwracken nach Belgien verkauft. Am 6. Mai d.J. wurde sie von dem Deutschen Schlepper OCHTUM nach Antwerpen verholt, wo der Schleppzug am 9. Mai eintraf. Das Schiff wurde 44 Jahre alt.
Ende

Foto: Bernhard Sander
|

Foto: Bernhard Sander
|
MS "MÜLHEIM-RUHR" im Dock.
➧ 
➧ 
➧ 
➧ 
➧ 
➧ 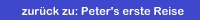
➧ 
letztes update: 1. August 2013
webdesign by hrs, casares 2011
© by Peter Wilhelm & hrs, casares 2011



















